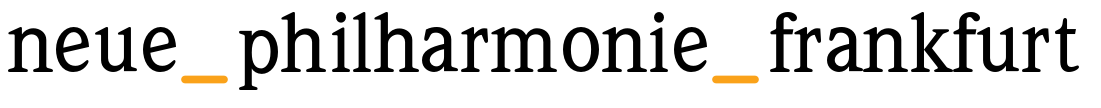Ein typischer Opernabend sieht heutzutage wohl so aus: Die Bahn hat Verspätung, es regnet in Strömen, nach einem Sprint durchs Foyer (Theaterjargon "Vorderhaus") wirft man der Garderobiere den nassen Mantel hin. Weil man den Saal von der falschen Seite betreten hat, muss eine gesamte Parkettreihe widerwillig, aber geschlossen aufstehen, und kaum hat man schweratmend seinen Platz endlich eingenommen, wird es auch schon dunkel. Freundlicher Applaus empfängt den Dirigenten, der sich, durch einen einzelnen Scheinwerfer (Theaterjargon „Glatze“) von oben erleuchtet, höflich verbeugt.
Dann - ein letztes Räuspern, gespannte Erwartung. In der Dunkelheit werden die Programmhefte beiseite gelegt, alle Blicke richten sich auf den geschlossenen Vorhang.
Stille.
Kaum ein Komponist hat sich diesen besonderen Augenblick entgehen lassen - den Moment höchster, ungeteilter Aufmerksamkeit des Publikums. Ein rotes Stück Stoff verbirgt, was uns erwartet. Welche Geschichten, welches Drama, welche Klänge? Dieser Moment bevor der "Lappen hochgeht" (Theaterjargon) ist der perfekte Moment für eine Ouvertüre!
Beginnen wir unseren kleinen Streifzug durch die Welt der Ouvertüre zu einer Zeit, als ein Opernabend nicht mit einer Bahn- oder Taxifahrt startet, sondern mit einer Kutschfahrt. Eine Zeit, in der die Sänger laufen lernen: Die Oper ist noch jung (als Geburtsstunde gilt im allgemeinen Claudio Monteverdis "Favola in Musica" L’Orfeo von 1607), die hochwohlgeborenen Köpfe sitzen alle noch fest auf ihren Schultern, Frankreich ist in Sachen Kunst und Kultur tonangebend im wahrsten Sinn, und der Hof Ludwigs XIV. ist das musikalische Zentrum der Welt. Hier wirkt Jean-Baptiste Lully, dessen Opern- und Ballet-Ouvertüren zum Vorbild werden, so wie das Schloss Versaille für fürstliche Residenzen in ganz Europa. Der pompöse Rhythmus von Einleitungs- und Schlussteil, die flotte Mitte mit den kunstvoll ineinander gewebten Stimmen, all das prägt die Ouvertüre bis weit ins 18. Jahrhundert.
Hören wir zu Beginn ein Prachtexemplar der Lullyschen Ouvertüre, die zu seiner Tragédie Lyrique Armide von 1686. Es spielt, formvollendet und standesgemäß, La Chapelle Royale unter Philippe Herreweghe:
Frische, festliche Musik - schade, dass sich Lully im Jahr darauf beim Dirigieren den Taktstock in den Fuß rammte und kurze Zeit später an den Folgen verstarb.
Musikalisch-inhaltlich hat diese Ouvertüre nichts mit der folgenden Oper zu tun, sie ist einfach nur ein „Achtung, es geht los“ fürs Publikum: Ouvertüren sind austauschbar, und das war ungemein praktisch, denn sie wurden immer als letztes komponiert, kurz vor der Premiere. Wurde die Zeit zu knapp, nahm man einfach eine andere. So recycelte zum Beispiel Gioacchino Rossini die Ouvertüre zu Aureliano in Palmira drei Jahre später für seine Oper Elisabetta, Regina d’Inghilterra - nur um sie kurz darauf als Ouvertüre zum Barbier von Sevilla ein drittes Mal zu verwenden!
Rossinis Diebische Elster wurde zur Premiere 1817 rechtzeitig fertig, Ouvertüre inklusive. Bereits während des Stücks gab es spontanen Applaus, und nach dem Schlussakkord tobte das Publikum vor Begeisterung. Unter den vielen hervorragenden Aufnahmen stoßen wir auf den britischen Dirigenten Thomas Beecham und das Royal Philharmonic Orchestra. Sir Thomas bricht keine Geschwindigkeitsrekorde, sondern kostet diese wunderbare Musik bis in die letzten Feinheiten aus - elegant, schwungvoll, mit Verve, Musikalität und Italianità:
Fast ebenso viel Auswahl an meisterlichen Ouvertüren wie bei Rossini finden wir bei Wolfgang Amadé Mozart. Mit der Hochzeit des Figaro ging Mozart ein Risiko ein, denn das aufmüpfige Drama von Beaumarchais hatte die Aristokratie entsetzt und die die Obrigkeit provoziert. „Détestable!“ schimpfte Ludwig XVI. Das Publikum war anderer Meinung - und Mozarts Oper wurde einer seiner größten Erfolge.
Die folgende Aufnahme der Figaro-Ouvertüre mit den English Baroque Soloists unter John Eliot Gardiner zeigt auf historischen Instrumenten wie rotzfrech Mozarts Oper ist - und wie sie in einer guten Inszenierung heute noch wirken kann:
Acht Jahre vor Le nozze di Figaro wurde in Bonn ein Komponist geboren, der nur eine einzige Oper schreiben sollte - zu dieser allerdings nicht weniger als vier Ouvertüren! Ludwig van Beethovens Fidelio (oder Leonore, wie er die Oper immer genannt haben wollte) ist ein Schmerzenskind: Neun Jahre schlug sich Beethoven mit dem Werk herum, und die Geschichte seiner vier Ouvertüren (genannt Leonore 1-3 und Fidelio-Ouvertüre) ist episch. Die kurze Zusammenfassung lautet: Leonore 1 wurde bereits vor der Premiere als „zu leichtgewichtig“ verworfen. Leonore 2 - die Ouvertüre der Uraufführung - war den Musikern zu schwer. Und Leonore 3 ist derart überwältigend, dass man die Oper danach fast gar nicht mehr braucht. Erst im vierten Anlauf, für eine Neuproduktion von 1814, fand Beethoven mit Ouvertüre Nr. 4, der Fidelio-Ouvertüre endlich das richtige Maß.
Hier nun Leonore 3. Dirigent der Aufnahme mit dem Chamber Orchestra of Europe ist der 2016 verstorbene Nikolaus Harnoncourt - typisch „sprechend“, bis ins letzte Detail ausgehört, spannend wie ein Krimi:
Richard Wagner sah sich als Nachfolger Beethovens. Er schrieb zwar jede Menge Opern, aber keine Ouvertüren - er schrieb Vorspiele! Was dasselbe ist, nur eben auf Deutsch. Die meisten dieser Stücke haben sich auch im Konzertsaal bewährt: stürmisch der Fliegende Holländer, prunkvoll das Meistersinger-Vorspiel, ätherisch-zart das Vorspiel zum Lohengrin, mystisch das zum Parsifal. Die Krone jedoch gebührt der Einleitung zu Tristan und Isolde - elf Minuten Schmachten und Sehnen wie sie kein anderer Komponist vorher oder nachher geschrieben hat.
Unsere Referenzaufnahme dirigiert der legendäre Carlos Kleiber. Die sagenumwobene Produktion musste dem gefürchtet perfektionistischen Dirigenten geradezu abgetrotzt werden: Nach zehn Orchesterproben und zwanzig Aufnahmesitzungen kam es zum Krach zwischen Dirigent und Dresdner Staatskapelle - Kleiber brach das Ganze ab und betrat nie mehr ein Studio. Die CD wurde mühsam aus allem bis dahin Aufgenommenen zusammengeflickt, der unglückliche Kleiber später zur Veröffentlichung überredet. Kaum zu glauben, aber wahr: Diese sensationelle Einspielung des Tristan-Vorspiels ist ein Durchlauf während einer Probe:
Vom größten italienischen Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts würde man auch die größten Ouvertüren erwarten. Aber Giuseppe Verdi bevorzugte meist kurze Vorspiele - pardon, „Preludios“ -, die ohne viele Umschweife wirkungsvoll zur Sache kommen. Ein paar schöne Ouvertüren gibt es dennoch, zu Macht des Schicksals und zu Luisa Miller, zu Nabucco und zur Sizilianischen Vesper.
Die gewichtigste seiner Ouvertüren schrieb Verdi für die Mailänder Premiere der Aida - zu hören hier in einer Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra unter Claudio Abbado:
Diejenigen, die Aida gut kennen, wundern sich nun, dass sie dieses Stück noch nie im Theater gehört haben. Warum wird es nicht gespielt? Nun, ähnlich wie Beethoven erkannte Verdi, dass mit diesem prächtigen Vorspiel das Publikum nur sehr schlecht auf die erste Szene der Oper (ein eher beiläufiger Dialog zwischen Radames und Ramphis) eingestimmt wird. Also verschwand die Aida-Ouvertüre in den Archiven des Ricordi-Verlags und tauchte erst 1942 in den USA wieder auf.
Auch Johannes Brahms sah sich als Nachfolger Beethovens. In der Zahl seiner Opern schafft er es, den Meister noch zu unterbieten - denn von Opern hielt Brahms ungefähr soviel wie vom Rasieren! Trotzdem haben wir von ihm zwei Ouvertüren: Die erste entstand 1879, als die Universität Breslau dem Komponisten die Ehrendoktorwürde antrug. Zunächst dachte Brahms, ein paar Zeilen per Postkarte würden wohl ausreichen als Dankeschön. Diskret bedeutete man ihm, dass man eine Komposition erwarte - eine „Doktor-Symphonie“ zum Beispiel, oder doch wenigstens ein feierliches Lied. Also besann sich Brahms eines besseren, verquirlte vier Studentenlieder zu einem fröhlichen orchestralen Potpourri und nannte das ganze Akademische Festouvertüre op. 80.
Es ist Brahms' unbeschwert heiterstes, ausgelassenstes Werk. Unter der Leitung von Bernard Haitink beweist ein glänzend aufgelegtes Concertgebouw Orchester seine Klasse - mit fabelhaften Streichern, knackig-transparentem Blech, perfekt intonierenden Holzbläsern:
So viel Heiterkeit war Brahms selbst suspekt - wo bleibt die Seriosität? Also schickte er dem op. 80 eine Tragische Ouvertüre op. 81 hinterher. Eins seiner am seltensten gespielten Werke…
Die Ouvertüre ohne Oper, genannt „Konzertouvertüre“, sie war im 19. Jahrhundert ein bei vielen Komponisten beliebtes Genre. Einer ihrer ersten Meister war Mendelssohn (Hebriden-Ouvertüre!), einer der späteren Tschaikowsky. Hier ist die großartige Konzertouvertüre Romeo und Julia, von der es eine Fülle fantastischer Einspielungen gibt, unter anderem mit von Karajan (am besten mit den Wienern) oder in jüngerer Zeit mit Gergiev und seinem Kirov Orchester. Aber die heißblütigste Interpretation gelingt Leonard Bernstein, der sich mit seinen New Yorker Philharmonikern ohne Hemmungen hineinwirft ins musikalische Drama:
Wem dabei nicht das Herz bricht, hat keins - ein Jammer, dass Tschaikovsky nur die Ouvertüre, aber nicht die Oper dazu komponierte!
Mendelssohns Ouvertüre zu Ein Sommernachtstraum schafft es, zweierlei gleichzeitig zu sein: Konzertouvertüre und Schauspielouvertüre. Komponiert hat der jugendliche Mendelssohn sie 1826 für den Konzertsaal; 17 Jahre später folgte, für eine Theaterproduktion im Neuen Palais in Potsdam, die restliche Bühnenmusik. Die Poesie, den Witz, den Duft einer Shakespeareschen Komödie hat nur der späte Verdi mit seinem Falstaff ähnlich erfolgreich musikalisch eingefangen - ein Stück für die einsame Insel.
Die folgende Aufnahme der Sommernachtstraum-Ouvertüre ist von der Sorte "Stardirigent fliegt morgens ein, macht mittags das Ding, und ist abends wieder weg". Wenn der Dirigent allerdings André Previn heißt, und das Orchester die Wiener Philharmoniker sind, ist das Ergebnis nicht zu schlagen: Genuss pur!
Jenseits der bekannten Klassiker gibt es auch bei der Ouvertüre spannende Entdeckungen zu machen - bestes Beispiel hierfür: Donna Diana. Der heute völlig zu Recht vergessene Emil Nikolaus Freiherr von Reznicek komponierte für seine völlig zu Recht vergessene gleichnamige Oper eine erstklassige Ouvertüre, die sich noch lange im Repertoire hielt (und älteren Konzertgängern als Titelmusik einer beliebten Fernseh-Quizsendung bekannt sein dürfte).
Steht die Donna Diana-Ouvertüre auf dem Programm, bricht bei fast allen Orchestern der Angstschweiß aus, so knifflig und heikel ist sie. Bei fast allen Orchestern - jedoch nicht bei den New Yorker Philharmonikern! Sie schütteln das scheinbar mühelos aus dem Ärmel, und zwar live, ohne Netz und doppelten Boden. Dirigent dieser sensationellen Aufnahme ist Zubin Mehta:
Chapeau!
Und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres kleinen musikalischen Spaziergangs. Die Konzertouvertüre wird von der moderneren "Sinfonischen Dichtung" ausgestochen, mit der Franz Liszt und später Richard Strauss Triumphe feiern, die Opern-Ouvertüre stirbt im 20. Jahrhundert einen raschen, bedauernswerten Tod: Im Wozzeck genügen vier, in Elektra drei, in der Salomé ganze zwei Takte Orchestervorspiel, dann wird auch schon losgesungen. Und auch der geschlossene Theatervorhang kommt aus der Mode - moderne Regisseure lieben es, Ouvertüren zu inszenieren.
Doch Totgesagte leben länger: Die Ouvertüre, von der Oper verlassen, schafft gerade noch rechtzeitig den Sprung über den großen Teich, hinein ins leichte Fach. 300 Jahre nach Lully bringt das Musical sein Publikum nach alter Tradition mit einer Ouvertüre in Stimmung, verschafft Spätkommenden Gelegenheit, ihren Platz zu finden, gibt einen Vorgeschmack auf das Vergnügen der nächsten Stunden.
In diesem Sinn: Eine Ouvertüre am Ende, ein Anfang als Rausschmeißer. Die charmante Overtüre zu Girl Crazy, von jenem genialen, viel zu früh verstorbenen Cross-over-Komponisten George Gershwin: